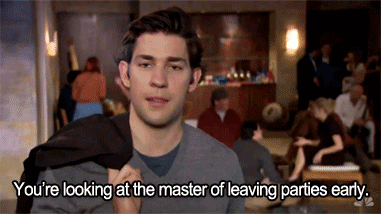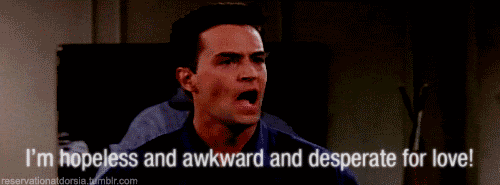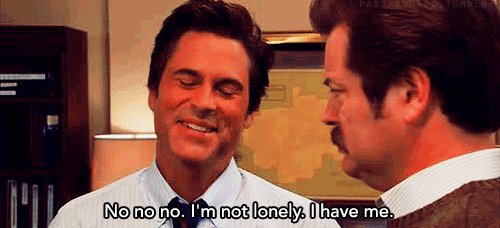„Shades of Grey" brachte BDSM raus aus der Schmuddelecke, rein in den Mainstream. Auf einmal war es nicht mehr verpönt, sich über solche Praktiken zu unterhalten. Ein wahrer Boost auch für BDSM-Portale.
Wir freuen uns sehr, dass der Gründer und Betreiber „Gentledom" sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen sehr offen und ausführlich zu beantworten.
Sprachlich wird "Gentle" am häufigsten im Englischen genutzt und steht dort für liebenswürdig und gütig. "Dom" ist dagegen die Kurzform von Dominus und bedeutet im Lateinischen Herr oder Gebieter.
Lieber Gentledom, wie entstand die Idee zu dieser Plattform?
Die Seite selbst ist als reines Aufklärungsprojekt ins Leben gerufen worden. Im Juli 2008 wurden binnen weniger Wochen zwei Bekannte bei Dates, die sie im Kontext BDSM hatten, missbraucht beziehungsweise vergewaltigt. Ich wollte einfach über die Risiken und Schutzmöglichkeiten aufklären.
Als jemand, der früher im Marketing aktiv war, merkte ich schnell, dass eine reine Informationsseite nur wenige Menschen erreichen wird. Daher startete ich damit, Infotainment zu betreiben. Infos, also auch gut verpackt, zum Beispiel in der Form erotischer Literatur, anzubieten.
Im Fokus stand dabei immer, dass es einen Mehrwert für die Aufklärung geben sollte. Besucher wünschten sich irgendwann die Möglichkeit, sich auszutauschen und wir eröffneten ein Forum. Da dieses flirtfrei sein sollte, gab es mit der Zeit das Bedürfnis nach einem Bereich, in dem auch geflirtet werden konnte und so haben wir eine Community errichtet, die der Partnersuche dient.
Wie würden Sie ein typisches Mitglied auf gentledom.de beschreiben?
Unsere Seite stellt wahrscheinlich nicht ganz den typischen Querschnitt der Szene dar. Uns ist ein gewisses Niveau sehr wichtig, wir wollen keine Mitglieder mit kommerziellen Interessen, wir erwarten gutes Benehmen, wir unterbinden copy&paste Nachrichten, unsere Admins sind Scherzbolde oder kurz: Wir sind einfach ein wenig anders. Unsere Mitglieder kommen aus allen Schichten, wobei wir vom Gefühl her etwas mehr Akademiker haben.
Wir haben wenige Mitglieder aus den neuen Bundesländern, der Schweiz und Österreich und der überwiegende Teil der Mitglieder favorisiert die sexuelle Rollenverteilung „Mann dominant" und „Frau devot". Dies liegt wahrscheinlich daran, dass ich als Namensgeber sehr viele Texte zu der Seite beigesteuert habe und selber ein dominanter Mann bin und somit als Autoren auch eher jene Zielgruppe gewinnen konnte, die meiner Neigung entspricht.
Somit sind leider die Neigung „dominante Frau" und „devoter Mann" bei uns stark unterrepräsentiert. Da die Seite aber inzwischen immer bekannter wird, kommt es hier langsam zu einem Ausgleich, was mich persönlich sehr freut.
Wie viele Nutzer loggen sich monatlich bei Ihnen ein?
Auch wenn wir professionell wirken und auch ein recht professionelles Produkt haben, sind wir es (zumindest) an dem Punkt Marketing nicht. Dies wird mir gerade wieder mal sehr bewusst, da ich keinen blassen Schimmer von den aktuellen Zahlen habe und wir solche Einloggstatistiken nicht einmal führen.
Zwar sind wir laut dem Alexa Trend Rank von den von deutschen BDSM Communities die Nr. 3 und liegen laut dieser Statistik vor diversen kommerziellen Seiten, wir haben aber in den ganzen Jahren nie kommerzielle Ziele verfolgt und uns deswegen nicht um solche Zahlen gekümmert.
Die Seite beschäftigt sich mit allem, was beim BDSM Spaß bereiten und/oder Risiken in sich bergen kann.
In den Spitzenzeiten sind im Forum und auf der Hauptseite zusammen rund 350 Personen gleichzeitig online und wir verzeichnen seit Juni 2014 fünfstellige Zahlen in Punkto Besuche pro Tag. Wie viele Besucher sich davon in die Community oder das Forum einloggen und wie viele die Seite nur als Informationsquelle nutzen, ohne eingeloggt zu sein, weiß ich nicht.
Ich vermute anhand der Onlinelisten, dass sich täglich mindestens 600 Mitglieder in der Community und mindestens 350 im Forum einloggen, häufig auch mehrfach pro Tag. Die Zahlen könnten aber auch deutlich höher liegen. Die gestiegenen Anforderungen bezüglich der Server haben die Kosten dieser innerhalb eines Jahres um rund 700% erhöht und es kann sein, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein Serverupgrade brauchen werden.
Welche Bereiche auf Gentledom richten sich eher an erfahrene BDSMler, und was finden Einsteiger, die erst kürzlich ihre Neigung entdeckt haben, hier?
Speziell für Anfänger sind die Bereiche „Schlagwörter" und „Grundlagen", in denen versucht wird, Ängste zu nehmen, Spielarten zu erklären, auf Sicherheitsaspekte hinzuweisen. Wobei BDSMler immer wieder, auch nach Jahren, neue Spielarten für sich entdecken können und somit auch ein erfahrener BDSMler hier Hilfe finden kann.
Im Bereich „Aus dem Leben" stehen Interviews und Erzählungen von BDSMlern mit sehr unterschiedlichem Erfahrungsstand, hier wird ein Einblick gewährt, um den Leuten zu zeigen, du bist mit deinen Gedanken, Sehnsüchten und vielleicht auch Zweifeln und Problemen nicht allein. Alle anderen Bereiche (Lounge mit vielen Geschichten, Blogs, Community, Forum) richten sich ausdrücklich an alle BDSMler, die Informationen, Unterhaltung und/oder den Austausch mit Gleichgesinnten suchen.
Ähnlich wie man das auch von niveauvollen Swinger-Communities kennt, gibt es auf Gentledom.de für Neueinsteiger Paten, die unerfahrenen BDSMlern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie lange braucht denn ein Anfänger in der Regel, um sich sicher in der Szene zu bewegen und nicht alle paar Meter in ein Fettnäpfchen zu treten?
Das hängt ganz von der Person ab. Manch einer wird nach 3 Tagen aus der Patenschaft „entlassen", da er/sie nur einige Fragen hatte und diese schnell zu beantworten waren und andere sind seit Monaten in einer Patenschaft. In der Regel erfolgt 6-8 Wochen lang eine aktive Betreuung.
Weil Anfänger oft eher zurückhaltend sind, erwischen sie gar nicht so viele Fettnäpfchen, die echten Kracher liefern da eher „erfahrene" BDSMler ab, die den Blick für die Realität verloren zu haben scheinen. Deswegen haben wir auch den DummDomAward ins Leben gerufen, wo wir die schönsten Stilblüten des Jahres küren, welche uns aus der Szene zugetragen werden.
Wie ist das Geschlechterverhältnis auf gentledom.de und wie gestaltet sich der Altersdurchschnitt?
Bei der letzten Erhebung vor ca. zwei Monaten hatten wir bei den registrierten Nutzern einen Frauenüberschuss, was uns selbst etwas erstaunt hat. Immerhin geht es bei uns um ein sehr sexuelles Thema, bei dem auf den uns bekannten anderen BDSM Seiten ein deutlicher Männerüberschuss vorherrscht. Dies führen wir darauf zurück, dass wir zu aufdringliche und niveaulose Personen schnell aus der Community und dem Forum entfernen und es auf den ganzen Seiten keine „anzüglichen" Bilder oder Videos gibt, wie sie sonst durchaus üblich zu sein scheinen. Ganz bewusst sind unsere Inhalte textlicher Natur und sprechen somit Menschen an, die nicht gaffen, sondern selbst denken und fantasieren wollen.
Unsere Kernaltersgruppe liegt zwischen 18 und 50 Jahren und gestaltet sich recht gemischt. Die einzige Gruppe, die etwas unterrepräsentiert ist, sind junge Männer bis 23 Jahre. Bei den realen Treffen, also den Stammtischen, die über das Forum organisiert werden, liegt der Altersdurchschnitt in etwa bei 35 Jahren.
Auf Ihrer Seite können Nutzer auch einen eigenen Blog zum Thema führen. Ist die Interaktivität mit der restlichen Community ein wichtiger Bestandteil der Plattform?
Ohne die Community würden die Blogs mit Sicherheit weitaus weniger Besucher haben. Wir haben es leider bisher noch nicht geschafft, die Blogs aktiv in die Community und das Forum einzubinden. Dies soll aber in den kommenden Monaten erfolgen, indem Neuigkeiten aus den Blogs in diesen Bereichen zusätzlich als Anleser gepostet werden.
Die Seite ist ja sehr komplex und die Inhalte breit gefächert - ist Gentledom eher als reine Online-Community gedacht oder steht auch die Partnersuche für "reale" BDSM-Kontakte gleichermaßen im Vordergrund?
Wir sind ein großer Gemischtwarenladen und jeder soll für sich den Bereich herauspicken, der ihm gefällt. Es gibt in Deutschland aktuell zehn offizielle Stammtische und dieses Jahr soll die gleiche Anzahl noch einmal hinzukommen. Daneben hatten wir bisher immer 2-3 Forumstreffen pro Jahr und es gibt auch noch weitere privat organisierte Treffen. Wir freuen uns sehr, wenn sich die Menschen treffen und es eben nicht bei dem rein virtuellen Austausch bleibt.
In der Community suchen die wenigsten Mitglieder einen Partner für Onlinespiele, wenn dann haben die meisten das Bedürfnis nach einem realen Partner, mit welchem sie BDSM nicht nur im Kopf, sondern auch am Körper und vielleicht sogar im Herzen spüren können.
Was sind die drei wichtigsten Bereiche auf gentledom.de? Also welche Bereiche/Kategorien werden am häufigsten besucht?
Von den Besuchszahlen her ist dies das Forum, wobei es die Frage wäre, ob man das Forum mit über derzeit mehr als 650 Beiträgen pro Tag nicht auch noch mal in seine Bereiche unterteilen müsste. Danach kommt unsere Community. Mit sehr ähnlichen Zugriffszahlen warten dahinter die BDSM Grundlagen, die Blogs (wobei diese auf zwei Bereiche aufgeteilt sind) und die Lounge (BDSM Geschichten und Romane) auf.
Ihre Community wächst und wächst. Ist das Interesse an BDSM seit dem Hype um „Shades of Grey" gestiegen?
Wir haben seitdem der erste Band von „Shades of Grey" veröffentlicht wurde immer mehr Besucher angezogen. Ein wirklich großes Wachstum setzte aber bei uns erst ein, als wir die Community im Dezember 2013 eröffnet hatten. Lag unser Rekord bezüglich der Anzahl der monatlichen Besuche vorher noch bei unter 3.000, so schnellte dieser binnen neun Monaten auf über 17.500. Wie viel dieses Wachstums nun „Shades of Grey" war und wie viel wir, ist schwer zu sagen.
Was mir sehr gefällt, ist, dass BDSM immer mehr in die Mitte der Gesellschaft durch dieses Buch gerückt wurde. Die Neigung wird nicht mehr als abartig oder krank wahrgenommen und dargestellt und dieses ermutigt immer mehr Menschen sich zu ihren geheimen Bedürfnissen zu bekennen. Ich begrüße diesen Trend sehr, auch wenn mir der Inhalt des Buches nicht zusagt und ich persönlich ein wenig davon genervt bin, in den Medien gerne als „der wahre Mr Grey" oder ähnliches bezeichnet zu werden. Mr Grey ist eine fiktive Figur mit der ich nach meiner Auffassung recht wenige Ähnlichkeiten habe.
Sie selbst als Macher der Seite bringen sich ja mit vielen Informationen zum Thema auf der Gentledom-Seite ein; denken Sie, in Sachen BDSM muss noch viel Enttabuisierungs-Arbeit geleistet werden, um das Thema für die breite Gesellschaft salonfähig zu machen?
Die Offenheit der Medien und das Entrücken des Themas raus aus der Schmuddelecke gefallen mir sehr gut. Hätte mir jemand vor „Shades of Grey" gesagt, dass dies binnen drei Jahren möglich ist, hätte ich ihn nicht ernst genommen. Wir haben den Schritt, den uns Schwule und Lesben vor vielen Jahren aufgezeigt haben, in Windeseile gemacht. Zwar gibt es auch bei uns Lobbyarbeit, aber diese war nie so gut organisiert wie jene der homosexuellen Mitbürger. Wie auch bei diesen gibt es bei uns trotz einer sehr positiven Tendenz hin zu mehr Offenheit und weniger Klischees noch einiges zu tun.
Es gibt dumme Klischees über BDSMler, genauso wie es dumme Klischees von BDSMlern gegenüber Nicht-BDSMlern gibt. Hier gilt es bei beiden Gruppen Aufklärungsarbeit zu leisten, weder sind wir alle krank, noch gestört, noch hatten wir eine schlimme Kindheit und genauso haben wir keine bessere Sexualität oder gar stabilere Beziehungen, weil wir offener miteinander umgehen.
Ich hoffe sehr, nicht nur die Vorurteile gegenüber uns, sondern auch die Vorurteile der BDSMler gegenüber anderen werden mit der Zeit abnehmen. Vorurteile baut man am besten durch Information und Kommunikation ab und daher gebe ich gerne Interviews und wir haben inzwischen bereits mehrfach auch Eltern und Partner von BDSMlern beraten, welche selbst keine solche Neigung aufweisen, sondern sich um eine nahestehende Person, die sich ihnen gegenüber als BDSMler geoutet hat, Sorgen gemacht haben.
In der Rubrik "Kleine Malheure" auf GENTLEDOM schreiben Sie über teils ausgenommen lustige Szenen aus Ihrem BDSM-Alltag ebenso wie über Situationen, in denen es ordentlich zur Sache geht. Lässt sich die Offenheit in diesem "intimen" Bereich strikt von Ihrem "bürgerlichen" Leben, etwa in Ihrem Jobkontext, getrennt halten?
Ich bin beruflich und privat weitestgehend geoutet. Als Volljurist befinde ich mich in der glücklichen Situation, unkündbar zu sein. Um eben nicht erpressbar zu sein, gehe ich offen mit meiner Neigung um. Dies bedeutet nicht, dass ich nun rumposaune, ich bin der Betreiber von gentledom.de, das wissen zum Beispiel eher wenige Personen.
Weitaus mehr wissen, dass ich ein nicht ganz unbekannter Autor bezüglich sexueller Themen bin und jeder weiß, dass ich privat mit dem Bereich BDSM zu tun habe. Niemand muss sich als BDSMler outen, als Betreiber eines so großen Webprojekts will ich aber nicht erpressbar sein. Probleme gab es deswegen bisher nur einmal, das war mit meinen Eltern, aber selbst diese habe meine Neigung nach einiger Zeit akzeptiert.
Wie sehen Sie die Zukunft von Gentledom.de? Gibt es neue Elemente, die Sie geplant haben?
Ich plane dieses Projekt nicht. In der Vergangenheit haben wir neue Bereiche eingeführt, wenn die Besucher der Seite diesen Wunsch an uns herangetragen haben und wir diesen für umsetzbar hielten. Ich finde die Nutzerwünsche zeigen einem Betreiber viel besser die Wünsche und Bedürfnisse seiner Besucher auf, als wenn ich mich mit einem kleinen Team in ein Kämmerlein setze und wir uns überlegen, was nun gut für das Projekt wäre.
Unser aktuell größtes Projekt ist ein BDSM Atlas, in welchem wir Studios, BDSM Appartements, Clubs, Ladengeschäfte usw. aufführen wollen. Langfristig wollen wir ein wissenschaftliches Partnermatching für BDSMler entwickeln, hier haben aber noch nicht einmal die Programmierarbeiten begonnen.
Daneben gibt es noch viele kleine Baustellen, wie eine Coverservice von Mitglieder für Mitglieder oder auch einen FSK18 Blog, den wir wegen den deutschen Jugendschutzvorschriften entsprechend schützen müssen. Tja, und wegen diesem Interview werden wir in diesem Jahr sicher irgendwann mal ein Analysetool einbauen, das uns sagt, wie viele Mitglieder sich eigentlich so pro Tag bei uns einloggen ;) In diesem Sinne: Vielen Dank, dass wir uns durch dieses Interview auch einmal als Betreiber hinterfragen!
Lieber Gentledom, wir bedanken uns herzlich für die offene Beantwortung all unserer Fragen und den kleinen Einblick in die BDSM-Welt, den Sie uns gewährten. Viel Erfolg und vor allem weiterhin viel Spaß mit diesem Projekt!
Dieses Interview ist ursprünglich auf www.singleboersen-vergleich.de erschienen.
Sie haben auch ein spannendes Thema?
Die Huffington Post ist eine Debattenplattform für alle Perspektiven. Wenn Sie die Diskussion zu politischen oder gesellschaftlichen Themen vorantreiben wollen, schicken Sie Ihre Idee an unser Blogteam unter blog@huffingtonpost.de.
Hier geht es zurück zur Startseite
Auch auf HuffingtonPost.de: Tipps von der Sexualtherapeutin:
Neue Liebesspiele für besseren Sex